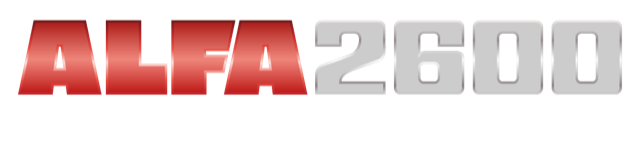Zukunfts-perspektiven
Wie sieht die Zukunft der klassischen Fahrzeuge aus?

Inhaltsübersicht
Was passiert mit unseren schönen, klassischen Fahrzeugen, wenn eines Tages alle Autos elektrisch und autonom fahren? Sind es dann alte Benzinstinker aus vergangenen Zeiten oder begehrenswerte Sammlerstücke?
Die Klimakatastrophe abzuwenden wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte sein. Aber macht es Sinn den Pessimisten zu folgen und zu stöhnen: „Es wird schlimm – vielleicht sogar noch schlimmer.“ Sollte man nicht lieber mit Optimismus an die Sache herangehen, Visionen und Lösungen entwickeln wie der Klimawandel mit Kreativität abzuwenden ist und wie wir technisches Kulturgut, also auch sammelnswerte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor künftig noch nutzen können.
Wenn die Zukunft als katastrophal dargestellt wird, wächst die Sehnsucht nach der Vergangenheit.
Fahrzeuge waren im 20. Jahrhundert natürlich auch reine Fortbewegungsmittel, aber viel mehr noch als heute Objekte der Begierde, die Freiheit, Geschwindigkeit und Fahrspaß versprachen. Über Emissionen dachte in den 1960er Jahren überhaupt niemand nach. Damals waren Autos einfach ein Traum, persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung – endlich konnte man sich bewegen wohin man wollte, andere Länder bereisen, das Auto ermöglichte erst den Tourismus der heutigen Zeit, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen – insofern war es auch ein Vehikel, das Verständnis für andere Menschen erzeugte und damit zumindest in Nachkriegseuropa zum Frieden beitrug.
Aber es war noch mehr: Es war eine Mischung aus Ingenieurskunst, Design und Ästhetik – Leistung, Effizienz, Geschwindigkeit standen auf der einen Seite und Anmut, Schönheit, Prestige auf der anderen. Autos waren Ausdruck des Fortschritts in eine rosige Zukunft.
Gerade die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts haben Fahrzeuge hervorgebracht, die mit genügend starken Motoren und passablen Fahrwerken schon enormen Fahrspaß erzeugen konnten und auf der anderen Seite bildschöne Karosserien hervorbrachten. Manchmal waren es echte Kunstwerke, die sich endgültig vom Kutschendesign der Vorkriegsjahre verabschiedet hatten, andererseits noch frei waren von den Beschränkungen, die Umwelt- und Sicherheitsgesetze später mit sich brachten und die die Autos immer gleichförmiger aussehen ließen.
Sie stellten eine faszinierende Mischung aus Ingenieurskunst und Design dar, sie waren Objekte der Begierde, Schönheiten und Sympathieträger, die Leistung, Geschwindigkeit, Freiheit und Prestige miteinander kombinierten. Fortbewegungsmittel, die heute ganz warme, nostalgische Gefühle erzeugen, weil man als Kind oder Jugendliche/r die ersten großen Reise-Erlebnisse hatte. Autos haben die Nachkriegs-Generation geprägt, mit dazu beigetragen, dass diese Generation Grenzen überwunden und persönliche Freiheit schätzen gelernt hat. Ohne Auto hätte man viele Freundschaften nicht geschlossen, viele Erlebnisse nicht gehabt.
Ist das Rechtfertigung genug um heute im Nachhinein zu sagen: Das zählt alles nicht – wir haben mit genau diesen Autos, diesen Vermittlern von persönlicher Freiheit, zur Zerstörung unserer Umwelt beigetragen und unseren Planeten an die Kippe zur unumkehrbaren Erwärmung gebracht.
Objekte der Zeitgeschichte: Kunst, Emotionen, Erlebnis, Leidenschaft, Sozialleben.
Man erkennt das heute noch an der Sympathie für klassische Fahrzeuge. Taucht im Straßenverkehr ein Fiat Topolino, ein VW Käfer oder ein alter Mercedes SL auf, dann huscht über viele Gesichter ein Lächeln, die Erinnerung an eine gute, alte Zeit blitzt hoch. Doch jetzt kommen diese klassischen Fahrzeuge, diese Publikumslieblinge in ein Dilemma: Oldtimerfahren in Zeiten der Klimakrise: Kann man die Leidenschaft zu klassischen Fahrzeugen mit einem überzeugenden Umweltbewusstsein verbinden? Geht das überhaupt? Ist das nicht ein krasser Gegensatz? Müssen deshalb Oldtimer in Zeiten des Klimawandels verboten werden oder muss man zumindest ein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal ein historisches Auto bewegt?
Zweifellos, eigentlich müsste man im Klimawandel jegliche unnötige CO2 Emission vermeiden. Und Oldtimerfahren, vor allem mit Autos ohne KAT, erzeugt CO2 Emissionen. Klar, einen Oldtimer fährt man nicht aus Notwendigkeit, sondern ganz überwiegend zum eigenen Vergnügen, allerdings auch zum Vergnügen vieler Zuschauer, die ein klassisches Fahrzeug als sympathisches Objekt aus der Vergangenheit, als „bella macchina“ bewundern. Muss man die sympathischen Klassiker deshalb stehen lassen, ins Museum oder aufs Abstellgleis schieben, gar verbieten?
Oldtimer sind ein Stück Zeitgeschichte.
Zu dieser Frage gibt es aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Antworten: Mobilität ist ein menschliches Bedürfnis, das das Auto perfekt erfüllt hat. Es gab die Freiheit der Entscheidung jederzeit überallhin fahren zu können, ohne Einschränkungen, ohne größere Organisation, ohne Wartezeiten. Das war die Welt speziell nach dem zweiten Weltkrieg, als Mobilität für jedermann erschwinglich wurde, als das Straßennetz immer weiter ausgebaut wurde. Das Auto versprach eine nahezu grenzenlose Freiheit der Bewegung, das auch noch schnell, komfortabel und problemlos (wenn man mal die heutige, hohe Verkehrsdichte und Staus außer Acht lässt).
Ähnlich war es viel später mit dem Bedürfnis nach Kommunikation, die das Handy perfekt erfüllte – man kann sich mit jeder Person überall in der Welt und jederzeit unterhalten. Man findet zusammen. Das Handy erfüllte zusätzlich ein weiteres menschliches Bedürfnis, das der Navigation. Wo bin ich? Wo will ich hin? Wie finde ich das möglichst schnell? Das Smartphone erfüllt diesen Wunsch sehr schnell und einfach. Individuelle Kommunikation und Navigation erfüllt das Handy in nahezu idealer Weise, aber eben nicht die Mobilität.
Wenn man seinen Körper physisch an einen anderen Ort bewegen möchte, der für das Zu-Fuß-Gehen zu weit entfernt liegt, braucht man ein Fahrzeug. Früher waren es Pferdekutschen, heute haben wir eine Vielzahl von Verkehrsmitteln – für den Nahverkehr erweisen sich Fahrrad, E-Bike oder Roller als ideal, es sei denn es ist sehr kalt oder es regnet in Strömen. Das Zweirad ist und bleibt sehr wetterabhängig. Für größere Distanzen bieten sich auch der öffentliche Nahverkehr, die Eisenbahn und das Flugzeug an. Doch diese Verkehrsmittel liefern auch einige gravierende Nachteile: Man ist an Fahrzeiten gebunden und zusätzlich an Haltestellen, Bahnhöfe und Flughäfen. Das schränkt die persönliche Freiheit ein. Man kann nicht spontan entscheiden: Jetzt gehe ich in die Garage, setze mich in mein Auto und fahre nach Lissabon oder Stockholm. Reisen in den öffentlichen Verkehrsmitteln dagegen müssen organisiert werden, brauchen zeitlichen Vorlauf und kosten meist auch noch mehr Geld als dieselbe Reise mit dem Auto, vor allem mit mehreren Personen. Noch dazu ist die Gepäck-Mitnahme meist deutlich eingeschränkt. Das merkt jeder sofort, der zum Beispiel versucht sein Fahrrad in der Bahn oder im Flugzeug mitzunehmen.
Das Auto – künftig natürlich das E-Auto – wird seine Berechtigung behalten, vor allem auf längeren Distanzen und auf dem Land, wo die öffentlichen Verkehrsmittel nicht lohnend sind, weil zu wenige Menschen sie nutzen. Ein größeres Maß an persönlicher Freiheit und Komfort bietet kein anderes Verkehrsmittel.
Die entscheidende Frage für Oldtimer: Was ist wichtiger – Komplette Vermeidung von CO2 Emissionen oder die Pflege des fahrzeugtechnischen Kulturgutes? Bisher schieben wir die Antwort vor uns her. Na ja, die Emissionen der Oldtimer im Verhältnis zum normalen Individualverkehr sind eigentlich so gering, dass sie überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Hier die Fakten: In Deutschland sind 48,25 Millionen Fahrzeuge zugelassen (Stand 2020). Dazu kommen rund 4,66 Millionen Motorräder, etwa 3,41 Millionen Lastkraftwagen sowie 2,3 Millionen Zugmaschinen. Im Gegensatz dazu stehen 857.000 Oldtimer, also 1,47 Prozent des normalen Verkehrs. Allerdings werden Oldtimer im Schnitt nur etwa 1000 Kilometer im Jahr bewegt, im Gegensatz zu durchschnittlich 13.700 Kilometer eines normalen Alltagsfahrzeugs. Das heißt, dass die Emissionen der Oldtimer gesamt nur etwa 0,1 Prozent des normalen Verkehrs ausmachen, auch wenn diese Emissionen zum Teil nicht KAT-gereinigt sind.
Kann man sich hinter diesem Argument zurückziehen? Darf man sagen: Die Emissionen der Oldtimer-Liebhaber sind so gering, dass sie überhaupt nicht ins Gewicht fallen? Oder soll man die reine Lehre bemühen und sagen: Jede Emission muss vermieden werden.
Die Lösung wird – wie so oft – in einem Kompromiss liegen. Niemand wird den klassischen Fahrzeugen ihre Sympathie absprechen und die meisten werden verstehen, dass die alte Mechanik bewegt werden muss, damit sie keine Standschäden bekommt. Es gilt also abzuwägen zwischen den im Vergleich zum normalen Verkehr äußerst geringen Emissionen der Oldtimer und der Pflege des fahrzeugtechnischen Kulturgutes. Dinge aus der Vergangenheit gehören zu unserem Leben, unserer Kultur, sind Teil unserer Identität. Oder sollten wir Schlösser aus dem 17. Jahrhundert und mittelalterliche Fachwerkhäuser in einer Altstadt abreißen, nur weil sie nach heutigem Maßstab zu viel Heizenergie verbrauchen?
Aber natürlich kann man über bestimmte Regelungen nachdenken: Eine eingeschränkte Nutzung, zum Beispiel nur an Wochenenden oder nur auf bestimmten Strecken würde jedoch nicht nur die persönliche Freiheit der Oldtimerfahrer:innen beschneiden, sondern auch schwer zu kontrollieren sein. Eine längere Urlaubsfahrt wäre dann gar nicht mehr möglich.
Schon eher könnte man sich eine Beschränkung des Oldtimer-Status nur für Fahrzeuge vorstellen, die über 40 oder sogar über 50 Jahre alt sind, so dass nicht ein nur gut gepflegtes Alltagsfahrzeug, das ansonsten wenig Faszination ausstrahlt und keinen „Kultstatus“ hat, einfach nur als preisgünstiges (Steuer und Versicherung) Alltagsmobil bewegt werden kann.
Disruptive Neuerungen
Im Laufe der jüngeren Geschichte hat es eine ganze Reihe von disruptiven Veränderungen in unserem Leben gegeben: Nehmen wir zuerst den Übergang von der Pferdekutsche zum Auto am Anfang des Jahrhunderts. Der Transport per Pferd hatte eine Reihe von extremen Nachteilen. Der Lärm, den die Pferdehufe auf dem Pflaster der Städte erzeugte, war vor allem nachts unerträglich. Noch schlimmer war aber das Problem des Pferdemists. In New York zum Beispiel wurde der Mist auf unbebauten Grundstücken bis zu fünf Stockwerke hoch gelagert – die Belästigung durch den Gestank und die Millionen von Fliegen war unerträglich. Das Auto war eine hochwillkommene Neuerung, die all das vermied. Über die Abgase dachte damals noch niemand nach. Heute sind Arbeitspferde komplett aus dem Straßenbild verschwunden. Aber Rennpferde kosten mehr denn je.
Oder nehmen wir etwa zur gleichen Zeit den Wandel von der Kerze und der Petroleumlampe zu elektrischem Licht: Die Vorteile der neuen Beleuchtungsform waren so gravierend, dass heute niemand mehr auf die Idee käme seine Wohnung mit Petroleumfunzeln zum beleuchten. Kerzen nutzt man nur noch um eine besondere Stimmung im Advent oder an Weihnachten zu erzeugen. Ähnlich verhält es sich beim Kaminfeuer im Verhältnis zur Zentralheizung oder in neuester Zeit beim Übergang von Kohle, Öl und Gas zur Wärmepumpe oder einer Solaranlage. Der Übergang von der Schreibmaschine zum Computer, oder vom normalen Algorithmus eines Programms zu selbstlernender künstlicher Intelligenz stellen ebenfalls disruptive Entwicklungen dar.
Ein weiteres Beispiel sind Tonträger von der Schallplatte zum Tonband, dann CD und schließlich Festplatte. Und ein noch deutlicheres Beispiel liefert der Übergang von der mechanischen Uhr zur Quarzuhr in den 1980er Jahren. Quarzuhren sind präziser und kostengünstiger. Und dennoch sind mechanische Uhren heute beliebter und teurer denn je. Die Frage lautet also: Was machen wir in Zukunft mit den alten Dingen, die eindeutig zum Kulturgut gehören, aber eben nicht mehr dem neuestem technischen Standard entsprechen und die bei ihrer Nutzung und Pflege Emissionen erzeugen, teurer sind oder andere Nachteile haben? Oder überspitzt gefragt: Wollen wir alle 80jährigen eliminieren, weil sie für die Gesellschaft nichts mehr bringen, außer vielleicht ein bisschen Erfahrung und ein paar Geschichten aus längst vergangener Zeit?
Heißt die Lösung E-Fuels?
Die bange Frage für Oldtimer-Fans lautet also: Wird es nach der Umstellung auf E-Autos, egal ob Batterie oder Wasserstoff, überhaupt noch Benzin geben? Mal abgesehen davon, dass die EU das Verbrenner-Aus (vorerst) für 2035 beschlossen hat, so gilt das natürlich nur für Neuwagen. Bis dahin werden also noch neue Verbrenner hergestellt, die danach natürlich noch eine normale Lebensdauer von zwei bis drei Jahrzehnten haben. Bis dahin wird also Benzin hergestellt werden müssen.
Noch nicht absehbar ist das, was unter dem Label Technologie-Offenheit in den nächsten Jahren entwickelt wird. Die Firma Porsche zum Beispiel fährt hier im Eigeninteresse einen innovativen Ansatz E-Fuels. Der Grund ist offensichtlich: Etwa 70 Prozent aller jemals gebauten Porsches sind noch fahrbereit. Solche wertvollen klassischen Fahrzeuge werden heute nicht mehr verschrottet oder stillgelegt, sie wollen auch in Zukunft bewegt werden. Um damit klimaneutral zu fahren, dürfen die Kraftstoffe nur noch CO2 enthalten, das vorher der Atmosphäre entzogen wurden. Porsche hat sich dazu maßgeblich an der Herstellung von E-Fuels in Chile beteiligt, die mit grüner Energie (Windkraft) hergestellt werden. Das ist nach heutigem Stand der Technik nicht sonderlich effizient, teuer und erzeugt hohe Transportkosten. Aber man geht davon aus, dass Besitzer teurer Oldtimer in Zukunft bereit sein werden fünf oder mehr Euro für den Liter E-Sprit auszugeben.
All diese Überlegungen lassen also den Schluss zu, dass es vielen klassischen Fahrzeugen in Zukunft ähnlich ergehen wird, wie mittelalterlichen Schlössern, Rennpferden oder mechanischen Uhren – sie werden teurer denn je. Und vielleicht stellt man sie sogar eines Tages unter Denkmalschutz.